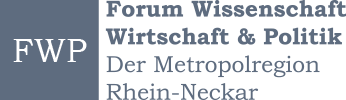Meinungsfreiheit und Cancel Culture
Rückblick auf die Vortragsveranstaltung
mit Julian Reichelt am 26. Juni 2025
mit Julian Reichelt am 26. Juni 2025
Julian Reichelt begann seinen Vortrag zum Thema „Meinungsfreiheit und Cancel Culture“ mit dem Satz „Wir gewinnen die gesellschaftliche Auseinandersetzung“. Damit war der positive Rahmen gesetzt. Reichelt führte aus, dass sich die geschlossenen Medienlandschaften mit Öffentlich-Rechtlichem Rundfunk und Mainstream-Medien als Irrweg erwiesen habe. Stattdessen erlebten Reichelt und seine führenden Journalisten bei jeder Reise durch Deutschland Wertschätzung. Die neuen Medien seien so zur „Befreiungsbewegung“ geworden.
Woher diese Perzeption über die neuen Medien kommt, warum und wodurch Meinungsfreiheit in Deutschland unter starkem Druck steht, was die Einschränkung von Meinungsfreiheit mit Bürgern, Gesellschaft und Demokratie macht und welche Rolle die neuen Medien darin spielen können, die Meinungsfreiheit zu verteidigen, darüber referierte Julian Reichelt ausführlich. Auch flocht er ein paar Anekdoten darüber ein, wie er selbst Cancel Culture erlebt hat.
Im Gegensatz zu den Ausführungen von Prof. Ferdinand Kirchof an selbiger Stelle im April sieht Reichelt die Meinungsfreiheit auch durch staatliche Akteure angegriffen. Menschen fühlten sich nicht mehr frei, ihre Meinung zu äußern, wenn sie damit rechnen müssten, dass wegen Meinungsdelikten morgens eine Hausdurchsuchung ansteht, wie zuletzt in der Woche des Vortrags bundesweit geschehen. Besonders perfide sei die Beschlagnahmung des Mobiltelefons, das heutzutage viele Funktionen des bürgerlichen und privaten Lebens ermöglicht. Noch perfider sei, dass Staatsanwälte ganz offen damit kokettierten, dass Ermittlungsmaßnahmen strafenden Charakter hätten, wie zuletzt ersichtlich in einer Dokumentation des US-Sender CBS.
Reichelt wies darauf hin, dass die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Knechtschaft und Dummheit führt. Ohne die Meinungsfreiheit seien Menschen Sklaven: Der freie Wille endet, damit endet die Demokratie, Menschen können sich nicht mehr wehren und auch nicht auf die grundgesetzlich garantierte Menschenwürde hinweisen. Nicht Gewaltenteilung sei der wichtigste Faktor der Demokratie, sondern Meinungsfreiheit, die dafür sorge, dass Macht kontrolliert werde.
Fehlt es an Meinungsfreiheit, dann stiegen die Dummen, Fanatischen auf. Ideologie mache sich unhinterfragt breit und auch skurrile Konzepte würden nicht mehr hinterfragt. Nur so ließe sich erklären, dass Themen wie Energiewende, Corona und Immigration mit erschreckender Unkenntnis verbreitet würden und Kritik an ihr nicht mehr stattfinde.
Nicht offenkundige Zensur sei das Mittel der Wahl zur Einengung des Sagbaren, sondern subtile Machtergreifung der Sprache. Mit Begriffen wie „Klimaleugner“ würden Assoziationsketten intendiert, die vom „Leugner“ zu „rechts“, von „rechts“ zu „rechtsextrem“, und von „rechtsextrem zu „gewalttätig“ und „mörderisch“ hinführen sollten. Weitere Beispiele seien der Gebrauch des Possessivpronomens von „Demokratie“ zu „Unsere Demokratie“ und das Voranstellung von „Die“ vor „Wissenschaft“. Beides verkehrten die ursprünglich sinnvollen und positiv besetzten Begriffe in ihr Gegenteil.
Als Hauptgrund für den Verlust an Meinungsfreiheit sieht Reichelt einen Kollaps der Medien. Das größte Problem sei ein mit zehn Milliarden jährlich finanzierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk und staatlich finanzierte politische Vorfeldorganisationen („NGOs“). Da Macht stets korrumpiert und den Charakter nicht immer zum Vorteil formt, habe sich nach der Bundestagswahl 2021 das neue Phänomen gezeigt, dass die Hauptstadtjournalisten sich als Wahlsieger empfunden hätten. In der Folge hätten sie sich gerade in der Covid-Zeit gemeinsam mit der Regierung gegen die Grundrechte der Bevölkerung verschworen. Reichelt wies darauf hin, dass die Presselandschaft vor der Bundestagswahl 2025 Friedrich Merz stark bekämpft habe, die Kritik aber nach der Amtseinführung verstummt sei. Dies wertete Reichelt als ein Anzeichen für die Komplizenschaft zwischen Politik und Medien.
Auch wäre die neue Bundesregierung stark in Versuchung, das Spiel mitzuspielen. „Machtkritik nervt die Mächtigen“, und auch wenn die Grenze zum Totalitarismus noch nicht überschritten sei, hätte die Gesellschaft in vielen Politikfeldern autoritäre Züge angenommen.
Als Indiz nannte Reichelt die Weigerung der Bundeskanzleramts, Ralf Schuler von NIUS zum Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz beim amerikanischen Präsidenten mitzunehmen. Es stehe auch einem Bundeskanzler nicht zu, gefällige von weniger gefälligen Journalisten zu unterscheiden. Bei offiziellen Terminen würden aber etliche ÖRR-Journalisten parallel berichten, wo ein ÖRR-Vertreter ausreichen würden.



Groß sei das Erstaunen gewesen, als es Julian Reichelt geschafft habe, sich die Reise ins Weiße Haus aufgrund von guten Kontakten in die US-Administration privat zu organisieren. Dieses Faktum sei nach dem eigentlichen Anlass gar das zweitwichtigste Thema in der Berichterstattung gewesen.
Reichelt berichtete von Washington, dass unter Donald Trump jeder Journalist jede Frage stellen dürfe, und der Präsident dann ehrlich sage, was er denkt und seine Gedanken in einfachen und klaren Worten abseits des üblichen Politiksprechs wiedergebe.
Überhaupt ginge von der neuen US-Administration eine neue, ansteckende Popkultur der freien Rede aus. Das Weiße Haus sei nach Ansicht der neuen US-Regierung das Haus des Volkes und der Präsident der höchste Angestellte der US-Amerikaner. Eine solche Haltung sei in deutschen Regierungskreisen noch undenkbar, aber eine neue Bewertung mache sich auch in der deutschen Bevölkerung breit.
NIUS mache es sich zum Schwerpunkt, Journalismus alter Schule wiederzubeleben, Mächtigen auf die Finger zu schauen und kritisch nachzufragen, wo es Missstände gibt. Dies sei erfolgreich, jeden Monat würden neun Millionen Menschen die NIUS-Berichte ansehen, und parallel hätten sich weitere Medien mit ähnlichem Erfolg und journalistischer Ethik etabliert.
Reichelt schloss mit der Beobachtung, dass es im Grundgesetz einen Konstruktionsfehler gebe. Der Verfassungsgeber war davon ausgegangen, dass die Exekutive nach den Erfahrungen des Dritten Reiches stets als Hüter der Grundrechte wirken würde. Es gebe aber keine Sicherungsmechanismen des liberalen Grundrechtsstaats vor der Exekutive, falls diese Grundrechte verletze (wie durch die Anordnung von Hausdurchsuchungen bei einfachen Meinungsdelikten). Aber: „Es gibt neue Medien, und die Sicherungsmechanismen sind wir.“